Maßnahmen gegen Klimawandel und Artensterben

Die Bau- und Immobilienbranche zählt weltweit zu den größten CO2-Emittenten und Abfallproduzenten. Durch den vermehrten Einsatz biobasierter Baustoffe – allen voran Holz – ließe sich das Problem lösen. Mehr noch: Mit einem Mal würden unsere Gebäude und Städte zu wertvollen CO2-Speichern. Wir haben über diesen Ansatz mit Dr. Matthias Ballestrem und Eva-Maria Friedel von Bauhaus Erde gesprochen.
Mit Sitz in Berlin und Potsdam verfolgt Bauhaus Erde ähnliche Ziele wie Drees & Sommer, beispielsweise im Hinblick auf die gezielte Wieder- und Weiterverwendung von Baumaterialien im Sinne des Urban Mining-Gedankens. Seit 2019 setzt sich die gemeinnützige Organisation für eine nachhaltige Bauwende ein. Das Besondere: Bauhaus Erde will aus Städten im Prinzip riesige CO2-Lagerstätten machen, indem dort in großem Maßstab Holz verbaut wird. Die Idee scheint so außergewöhnlich, dass wir selbst nachgehakt haben.
Herr Dr. Ballestrem, Frau Friedel – woher kommt eigentlich der Name „Bauhaus Erde“ oder, wie es auf Ihrer englischsprachigen Website heißt: „Bauhaus Earth“?
Matthias Ballestrem: Der Name Bauhaus Erde ist etwas missverständlich, weil er mehrere Assoziationen weckt – etwa historische zur Kunstschule Bauhaus in den 1920er- und 30er-Jahren, aber auch zeitgenössische zu einer fast gleichnamigen Baumarktkette.
Aber konzeptionell ist der Begriff für uns absolut passend, weil er eben die bewusste Referenz auf die Kunst- und Architekturschule betont. In dieser ging es damals – wie uns heute – um einen interdisziplinären Ansatz, um so die großen Herausforderungen unserer Zeit anzugehen und gemeinsam zu meistern.
„Bauhaus der Erde“ heißen wir ja ganz offiziell. Dieses „Erde“ ist natürlich auch in seiner Doppeldeutigkeit gewollt: Einerseits bezeichnet das den Globus, die ganze Welt, das ganzheitliche Denken. Andererseits das braune Zeug, was wir alle kennen, weil wir eben tatsächlich diese sehr starke Konzentration auf das biobasierte Bauen und auf biobasierte Materialien haben. Das war ein Grundgedanke von Prof. Hans Joachim Schellnhuber bei der Gründung von Bauhaus Erde.
Kerngedanke dabei ist, dass wir die Photosynthese als eine wirksame Methode verstehen und einsetzen müssen, um die Klimagase wieder aus der Atmosphäre herauszuholen und langfristig zu binden. Im Bausektor würden wir damit zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: eine CO2-Bindung in den Baustoffen selbst erreichen und zugleich die bislang sehr schlechte CO2-Bilanz der Branche verbessern.
Wie positioniert sich Bauhaus Erde, um diese Ziele umzusetzen?
Eva-Maria Friedel: Wir sehen uns als Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Baupraxis. Das zeigt sich etwa darin, dass wir an unserem Standort in Berlin Marienpark eine große Werkstatt haben, in der wir neue Materialien und Materialaufbauten erforschen.
Gleichzeitig arbeiten wir eng mit Forschungseinrichtungen wie dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) zusammen. Das heißt, dass wir klar den wissenschaftlichen Ansatz verfolgen, letztlich aber auf die Übertragung unserer Erkenntnisse in die Praxis zielen. Nur so können wir es schaffen, zu einer regenerativen gebauten Umwelt zu kommen.
Wie fallen die Reaktionen aus der Baubranche aus? Welche Resonanz erhalten Sie von Unternehmen?
Eva-Maria Friedel: Wir werden in jedem Fall stark nachgefragt. Beispielsweise bieten wir viele Weiterbildungen an, auch für Bauunternehmen. Dabei kommen insbesondere kleinere Unternehmen auf uns zu, die neue Materialien auf den Markt bringen wollen.
Matthias Ballestrem: Das zeigt für mich, dass Bauhaus Erde ebenso ein Think-Tank wie ein Make-Tank ist, der Veränderungen anstößt und umsetzt. Denn immer wieder haben wir den Eindruck, dass die Unternehmen selbst sehr stark die Veränderung wollen. Aber sie kommen aus ihrem Tagesgeschäft nicht so leicht heraus, um neue Systeme und Abläufe anzugehen. An dieser Stelle können wir helfen.
Was nehmen Sie als größtes Hindernis auf dem Weg zu Veränderungen wahr? Ist es Gewohnheit oder Angst vor unkalkulierbaren Kosten?
Matthias Ballestrem: Aus meiner Sicht ist es relativ oft ein Mix von beidem. Wenn dann zumindest die Gewohnheit einmal durchbrochen ist, dann zieht das Kostenargument und dann geht es sozusagen wieder zurück.
Wichtige Stellschrauben, an denen man drehen müsste, wären daher beispielsweise die Bepreisung von Baustoffen oder auch das Zertifizieren und Skalieren der Herstellung von neuen biobasierten Baustoffen.
Eva-Maria Friedel: Aus meiner Erfahrung als Projektleiterin in einem Planungsbüro kann ich bestätigen, dass sehr viele Entscheidungen von den Kosten abhängen. Oft ist es aber auch eine Frage der terminlichen Verfügbarkeit bestimmter Baustoffe. Darüber hinaus stelle ich jedoch eine grundsätzliche Haltung fest, die in etwa so geht: ‚Wir machen jetzt noch schnell die Quartiersentwicklung auf konventionellem Weg fertig und können dann im Anschluss vielleicht irgendwann ein einzelnes Pilotgebäude aus Holz bauen.‘
Wie sieht es bei den Bauregularien aus, die ja häufig Entscheidungen beeinflussen dürften? Sind diese bereits auf den vermehrten Einsatz von Holz hin ausgelegt?
Eva-Maria Friedel: Da wird es in der Tat schnell schwierig. Beispielsweise, wenn es in der Muster-Holzbaurichtlinie um Brandschutzanforderungen für höhere Gebäude der Gebäudeklassen 4 und 5 geht. Da tun sich schon einige Hürden auf, wenn man diesen Baustoff einsetzen will.
Werden wir etwas konkreter: „Retimbering the cities“ heißt ein zentraler Gedanke von Bauhaus Erde. Also etwa ‚Bringen wir das Holz wieder in die Städte‘. Welche Größenordnungen muss man sich da vorstellen? Denn lediglich um die Dachstühle von neuen Einfamilienhäusern kann es ja nicht mehr gehen.
Eva-Maria Friedel: Nein, sicher nicht. Dennoch empfehle ich grundsätzlich, beim Wohnungsbau zu starten, weil das konstruktiv das einfachste Segment ist, um Holz zu verwenden. Wenn es um den Industriebau und ähnliches geht, haben wir es schnell mit weit komplexeren Auflagen zu tun. Und beim Tiefbau gilt das erst recht. Im erdberührten Bereich und bei Gebäuden mit sehr hohen Anforderungen an Brandschutz oder Schadstoffschutz kommen wir meines Erachtens nicht umhin, neben Holz weiterhin mineralische und synthetische Materialien einzusetzen. Ganz werden diese Stoffe also nicht verschwinden.
Das heißt, der Wohnungsbau ist ein sinnvolles Segment, in dem man auf den Baustoff Holz umsteigen sollte. Dabei geht es selbstverständlich um den mehrgeschossigen Wohnungsbau. Aber auch Projekte im Schul- und Bürobau sollten zukünftig aus Holz und anderen regenerativen Materialien realisiert werden – überall wo es möglich ist, ressourcen- und klimaschonende Baustoffe einzusetzen, sollten wir das tun.
Grundsätzlich ist das Bauen mit biobasierten Materialien aber nur ein Hebel von vielen. Davor kommen noch andere. Auf jeden Fall steht an erster Stelle der Schutz des Gebäudebestandes. Es geht also darum, nicht mehr so viel abzureißen und neu zu bauen. Grund ist, dass wir im Bestand sehr viele graue Emissionen haben und es daher Sinn macht, den Bestand weiter zu nutzen, zu transformieren und zu sanieren oder aufzustocken. Das gilt gerade für die Innenstädte. Dieser Ansatz wird in Deutschland leider noch immer zu wenig verfolgt.
Matthias Ballestrem: Ich glaube, dass das auch eine kulturelle Transformation in den Köpfen voraussetzt. Deshalb versuchen wir prototypische Anwendungen zu entwickeln und beispielhaft Projekte zu realisieren, mit denen wir zeigen, was möglich ist.
Und ich denke, dass es daneben eine Veränderung der architektonischen Ausdrucksform braucht, weil die Architektur der Zukunft nach anderen Prinzipien arbeitet. Da wird es viel um Reparatur und Collage gehen, darum, altes neu zusammenzufügen und so weiter. Das ist natürlich eine Gegenthese zur perfekt verputzten Wand, zu reinweißen Räumen und den ganzen Standards, die bei Bauabnahmen im Moment üblich sind. Und da kommen im Bestand wieder biologische Baustoffe ins Spiel, etwa bei den Dämmungen. Das heißt, es muss gar nicht immer nur um Holz gehen. Allen ist klar, dass man sozusagen sehr smart und gut geplant mit Biomaterialien umgehen muss.
Lassen Sie mich einen Einwand formulieren: Wenn man den Holzbau durch eine stärkere Vorfertigung und Modularisierung industrialisiert und forciert – muss man dann nicht auch die vorgängigen Prozesse und Rohstoffketten auf mehr Output trimmen? Aber was eine industrialisierte Forstwirtschaft bedeutet, das sieht man ja eigentlich schon: von Hitze und Schädlingen angeschlagene Fichten-Monokulturen, Sturmschäden, flächige Kahlschläge, große Walderntemaschinen („Harvester“), die den Waldboden verdichten.
Befindet man sich da nicht in einem Dilemma: Man bräuchte für eine Bauwende mehr Holz, viel mehr Holz. Unser Wald steht aber bereits als Ökosystem massiv unter Druck – kann er das überhaupt leisten? Tauschen Bau- und Forstwirtschaft sich schon diesbezüglich aus?
Matthias Ballestrem: Ja, das machen wir als Bauhaus Erde ganz gezielt. Wir betonen auch immer, dass wir den Bedarf an Baustoffen von den Ökosystemen ausgehend denken müssen, also sozusagen immer von der Erde aus. In dieser Hinsicht begleiten und beraten wir unsere Partner und arbeiten dazu unter anderem stark mit Case Studies. Inzwischen kennen wir etwa viele Förster und haben Kontakte zu Sägewerken. Daneben habe ich schon viel Zeit im Wald verbracht, um sowohl mit öffentlichen als auch privaten Waldbesitzern zu sprechen.
Dabei merken wir, dass das ein sehr umkämpftes Feld ist und dass gegenwärtig verschiedene Ansätze miteinander konkurrieren, wie man den Wald im Klimawandel nachhaltig bewirtschaftet. Wir beobachten eine starke Polarisierung der Debatte, zum Beispiel um die notwendigen Regularien oder um die Frage, wie und welche neuen Baumarten man im Zuge des Klimawandels hierzulande ansiedelt. Es gibt momentan kein Rezept, von dem alle überzeugt sind, wie der Wald der Zukunft auszusehen hat. Man ist daher ein Stück weit aufs Experimentieren angewiesen. Dass dabei das wirtschaftliche Risiko des Staates als Waldbesitzer gegenüber dem der privaten Waldbesitzer viel geringer ist, macht es nicht einfacher.
Was kann man in so einer Situation als Bauhaus Erde tun?
Matthias Ballestrem: Wir bieten uns den Akteuren als Diskussionsplattform an. Zum Beispiel errichten wir gerade in Potsdam einen experimentellen Holz-Pavillon, der ab 2024 mit Themen rund um die Bauwende bespielt werden und als Forum dienen soll. An solchen Orten wollen wir unser Netzwerk zusammenbringen und die notwendigen Debatten führen.
Welche Rolle spielt bei Ihnen der Kreislaufgedanke?
Eva-Maria Friedel: Ganz eindeutig eine zentrale. Vor allem aber halte ich es für wichtig, bei Holz an die sogenannte Kaskadennutzung zu denken. Das bedeutet, die wertvolle Ressource Holz in zeitlich aufeinanderfolgenden Schritten mehrfach zu verwenden: vom Vollholz über spanbasierte Baustoffe zu Holzfaserprodukten. Im Moment ist es in Deutschland meistens so, dass Holz direkt als Brennholz verwertet wird und überhaupt nicht als Bauholz zum Einsatz kommt.
Für eine echte zirkuläre Verwendung von Holz müssen wir in Zukunft vor allem die Lieferketten prüfen, dann aber auch die Nutzung, um das Holz so lange wie möglich wirklich im Kreislauf halten zu können. Dem geht voraus, dass wir uns grundsätzlich Gedanken machen sollten, was wir mit unserem Holzvorrat hierzulande anstellen wollen.
Matthias Ballestrem: Wenn sich die Waldbewirtschaftung heute auf einen gemeinsamen Punkt – bis auf wenige Ausnahmen – einigen kann, dann auf den, dass der Wald der Zukunft ein Mischwald aus vielen verschiedenen Baumarten ist und dass die Zeit der industrialisierten Monokulturen vorbei ist. Parallel muss man beobachten, welche Baumarten mit dem Klimawandel zurechtkommen. Hinzu kommen Fragen der Bejagung, der Umzäunung von Neuanpflanzungen zum Schutz vor Verbiss oder dazu, wie man mit invasiven Baumarten umgeht.
Wie sieht es auf europäischer Ebene oder global aus? Ist man dort weiter als in Deutschland?
Eva-Maria Friedel: Ich habe das Gefühl, dass Deutschland ein wenig zurückbleibt. Wenn ich zum Beispiel schaue, was in den Nachbarländern in Sachen biobasiertes Bauen läuft, insbesondere in Österreich und der Schweiz, passiert da viel mehr in Sachen Holzbau. Aber auch in Skandinavien tut sich vieles. Dort ist es beispielsweise bereits möglich, Aufzugsschächte und Treppenhauswände im mehrgeschossigen Holzbau aus Massivholz zu planen und zu bauen. Das ist in Deutschland aufgrund unserer strengen Brandschutzrichtlinien gar nicht möglich.
Matthias Ballestrem: Was das Arbeiten mit Stroh angeht oder mit anderen Biobaustoffen ist zum Beispiel Frankreich schon weit vorn. Ähnlich ist es in Dänemark, wo es diesbezüglich viele Forschungskollaborationen zwischen Privatwirtschaft und Universitäten gibt. Kurz: Im europäischen Kontext ist Deutschland kein Vorreiter beim biobasierten Bauen.
Global gesehen liegen die Dinge etwas anders. Da hat Europa schon noch etwas Vorsprung, allerdings versuchen wir in den Ländern des globalen Südens gezielt Kooperationsprojekte voranzutreiben und uns mit Initiativen dort auszutauschen. Grund ist, dass die Städte der Zukunft vor allem dort gebaut werden. Hinzu kommt, dass es dort ganz andere Ökosysteme mit anderen Wachstumsbedingungen gibt und man dementsprechend auf andere Biobaustoffe zugreifen kann, etwa auf schnell wachsenden Bambus.
Was müsste in Deutschland passieren, damit der Knoten platzt? Muss man stärker auf die politischen Akteure einwirken?
Eva-Maria Friedel: Das machen wir bereits – und bewegen da schon einige ‚Hebel‘ parallel. Zum Beispiel arbeiten wir im Bündnis bezahlbarer Wohnraum mit, wo immer wieder diese Themen aufkommen. Etwa, wenn es um die Frage geht, ob und wie wir die angekündigten 400.000 Wohnungen pro Jahr bauen sollen. Diesbezüglich haben wir natürlich unsere eigene Sicht und machen Vorschläge, wie das unserer Meinung nach laufen kann und wie man dabei auf biobasierte Materialien setzen kann.
Grundsätzlich gibt es in Deutschland viele Regularien und Normen, die es nicht unbedingt einfacher machen, mit nachwachsenden Rohstoffen zu planen und zu bauen. Es klang ja bereits an. Aber da tut sich jetzt so langsam etwas, beispielsweise mit der Einführung der Gebäudeklasse E, bei der für das experimentelle Entwerfen und Bauen einige Regeln nicht ganz so streng sind. Genau in diese Richtung muss aber auf jeden Fall noch viel mehr passieren. Zum Beispiel muss es eine Novellierung der Muster-Holzbaurichtlinie geben, wenn wir im mehrgeschossigen Wohnungsbau etwas erreichen wollen.
Matthias Ballestrem: In meinen Projekten erlebe ich, dass es einen relativ großen Bedarf gibt, an der Schnittstelle zwischen Materialentwicklung und der Skalierung dieser neuen Materiallösungen anzusetzen. Ich denke, dass da mit einer gezielten Förderung viel bewegt werden könnte. Weiter müsste man darauf schauen, gezielt bestimmte Materialeigenschaften weiterzuentwickeln – etwa beim Brandschutz. Oftmals liegt die Initiative da bei einer Uni oder einem kleinen Unternehmen, die dann aber ab einem bestimmten Punkt nicht mehr weiterkommen.
Also brauchen wir eine Hilfe beim Brückenschlag in den Markt und in die Menge hinein. Denn es ist eben einfach unsere Tradition in Deutschland, und die industrialisierte Herstellung ist ein wichtiger Punkt, sonst werden wir mit konventionellen Baustoffen nicht konkurrieren können. Das gilt auch dann, wenn die CO2-Preise weiter steigen.
Eva-Maria Friedel: Zwei Punkte halte ich in diesem Zusammenhang für wichtig. Einmal die Akzeptanz in der Bevölkerung für biobasiertes Bauen – da können und müssen wir sicher noch viel Arbeit leisten, etwa indem wir mehr beispielhafte Projekte umsetzen. Denn wenn man das Gebäude einmal stehen hat und man die Materialien sehen und anfassen kann, dann ist das etwas ganz anderes, als wenn nur darüber gesprochen wird.
Ergänzend müssen wir in die Bildung investieren. Unter anderem an den Universitäten, wo wir gezielter das nachhaltige Bauen lehren müssen, damit die Planenden künftig wissen, wie man zum Beispiel mit Holz konstruiert. Genauso wichtig ist es bei der Ausbildung von Handwerker:innen, dass es dort auch neue Berufsformen gibt mit dem Ziel des zirkulären Bauens.
Wir haben viel über Holz gesprochen. Gibt es daneben noch weitere Biobaustoffe, für die Sie schon in der Breite Anwendungsmöglichkeiten sehen?
Eva-Maria Friedel: Ja, die gibt es durchaus …
Matthias Ballestrem: … und sie sind für uns sehr vielversprechend. Grundsätzlich haben wir ein Auge auf alles, was Photosynthese betreibt. Denken Sie an Stroh als Baustoff, etwa aus dem normalen Ackerbau aber auch aus Mooren. Oder Gräser. All diese Materialien funktionieren gut. Und daneben gibt es auch fantastische Entwicklungen aus Rohrkolben. Gerade dieses Material eignet sich sehr gut als Ersatz für Grobspanplatten (OSB), allerdings liegen dafür die nötigen Zertifizierungen noch nicht vor.
Trotzdem: Ein OSB-Ersatz wäre toll, vor allem, was die aussteifende Wirkung angeht. Damit hätte man schon relativ viel gewonnen. Aber damit noch nicht genug. Inzwischen rücken sogar Reis oder Muscheln als mögliche Baustoffe in den Blick. Und diese Diversifizierung ist auch extrem wichtig, damit wir nicht wieder in die gleiche Übernutzungsdiskussion reinkommen wie beim Holz.
Eva-Maria Friedel: Wenn es um regenerative Materialien geht, würde ich auf jeden Fall auf den Baustoff Lehm eingehen wollen. Lehm bietet sich ideal an, auch um die anderen Materialien zu ergänzen. Das ist etwa dann der Fall, wenn wir in Holzständerbauweise oder auch mit Stroh bauen. Dann können wir gut mit Lehm aufputzen, was auch aus Sicht des Brandschutzes sehr gut funktioniert. Hinzu kommen weitere positive Eigenschaften wie der gute sommerliche Wärmeschutz, einfach weil wir mit Lehm mehr Speichermasse im Gebäude schaffen.
Bei Bauhaus Erde haben zwei Fachkollegen einen speziellen Lehmstein entwickelt, für den wir jetzt die Materialzulassung haben. Man kann diesen Stein bis zur Gebäudeklasse 4 [also Gebäude mit maximal fünf Geschossen und Nutzungseinheiten mit jeweils nicht mehr als 400 Quadratmeter, Red.] als tragendes Element einsetzen. Besonders ist an diesem Lehmstein, dass dafür nicht-kontaminierter Baustellenaushub verwendet wird. Dieser Aushub wird sonst normalerweise einfach auf Deponien gelagert oder in Straßen verfüllt.
Das hört sich sehr vielversprechend an. Lassen Sie uns zum Abschluss in die Zukunft blicken: Wo stehen wir in circa zehn Jahren – also etwa Mitte des 2030er-Jahrzehnts – mit dem Holzbau oder dem biobasierten Bauen allgemein?
Eva-Maria Friedel: Klar ist, dass wir, um den Klimawandel noch wirksam zu begrenzen, jetzt auch und gerade im Gebäudesektor schnell handeln müssen. Also hoffe ich, dass vieles, was wir angesprochen haben, tatsächlich schon in den nächsten zehn Jahren umgesetzt wird.
Ganz vorne mit dabei werden sicher viele Maßnahmen im Gebäudebestand sein. Einfach aus dem Grund, weil sich hier schon mit relativ einfachen regulatorischen Änderungen viel bewegen lässt. Beispielsweise dass man den Abriss schärfer reglementiert und so auf nachhaltige Sanierungen hinwirkt. Das halte ich für total logisch und auch gut machbar. Damit einhergehend sehe ich, dass das zirkuläre Bauen weiter vorangetrieben wird. Und beide Ansätze – Bauen im Bestand und der Kreislaufgedanke – könnten schließlich um biobasierte Ansätze ergänzt werden.
Matthias Ballestrem: Auch ich würde mir wünschen, dass wir durch das Umbauen und Sanieren insgesamt einen großen Schritt Richtung Klimaneutralität gemacht haben werden. Zumindest in Deutschland. Einberechnet ist da sicher die Bilanzierung durch ein CO2-negatives Bauen mit biobasierten Materialien, aber natürlich werden Beton und ähnliche Stoffe nicht völlig verschwunden sein. Aber in der Gesamtbilanzierung von Projekten müssen wir eben auf null kommen.
Insgesamt bleibt aber auch damit noch viel zu tun – Stichwort CO2-neutraler Gebäudebetrieb. Denn ein erheblicher Teil der CO2-Emissionen entsteht ja durch den Betrieb. Hier wird parallel ebenfalls viel passieren müssen.
Eva-Maria Friedel: Immens an Bedeutung gewinnen wird in den kommenden Jahren wohl die Frage, wie wir den Flächenverbrauch endlich wirksam begrenzen. Jeder nicht bebaute Quadratmeter ist wichtig. Bislang geht der langjährige Trend immer noch dahin, dass wir in Deutschland immer mehr Fläche auch fürs Wohnen verbrauchen. Das heißt, ich sehe uns verstärkt an neuen Wohnformen arbeiten, in denen man sich wieder Räume teilen kann. Mir fallen hier positive Beispiele wie das Clusterwohnen oder das Mehrgenerationenwohnen ein. Ich denke – und hoffe –, dass sich die Dinge in diese Richtung entwickeln werden.
Dr. Matthias Ballestrem ist Leiter des Bauhaus-Erde-Fellowship-Programms, studierter Architekt und früherer Professor für Architektur und Experimentelles Design an der HafenCity University Hamburg
© Annette Koroll
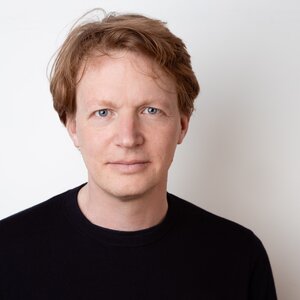
Eva-Maria Friedel ist Senior Researcher am Bauhaus Erde, studierte Architektin mit dem Fokus auf lokale und regenerative Baumaterialien


